Historisch war man lange Zeit der Überzeugung, dass bei einer vorliegenden Schwangerschaft die Plazenta einen grundsätzlich geschützten Barriere-Effekt bietet und kein signifikanter Zellen- oder Molekülaustausch von Mutter zu Kind bzw. umgekehrt stattfindet. In vielen Lehrbüchern wurde die Vorstellung vertreten, dass der maternale und fetale Kreislauf getrennt seien.
Aus heutiger Sicht weiß man aber, dass es bereits während der Schwangerschaft zu einem Austausch kommt, der sich allerdings auf eine sehr begrenzte, selektive parazelluläre und zelluläre Übertragung beschränkt.
Schon in den 1950er bis 1970er Jahren wurden erste Hinweise auf fetale Zellen im mütterlichen Kreislauf bzw. auch umgekehrt mütterliche Zellen im kindlichen Gewebe beobachtet. Ab den 1990er Jahren gab es zunehmende Belege für den bidirektionalen Austausch und den sogenannten fetalen Mikrochimärismus, der die frühere Annahme der völligen Undurchlässigkeit der Plazenta widerlegte.
Der Begriff Mikrochimärismus setzt sich zusammen aus den griechischen Wörtern ´Mikro`, also ´klein` und ´Chimära`, dem Namen eines Mischwesens aus Ziege, Löwe und Schlange aus der griechischen Mythologie.
Fetaler Mikrochimärismus bezeichnet das Phänomen, dass fetale Zellen, sowie deren DNA während der Schwangerschaft in den Körper der Mutter gelangen, sich dort etablieren und somit auch nach der Schwangerschaft über Jahre oder Jahrzehnte persistieren können. Auch bei nicht vollendeten Schwangerschaften wird dieses Phänomen beobachtet, im Gegenteil, scheint ein Schwangerschaftsabbruch möglicherweise die Wahrscheinlichkeit eines Mikrochimärismus sogar zu erhöhen.
Die fetalen Zellen, die als Pregnancy-Associated Progenitor Cells, PAPC, bezeichnet werden und eine Ähnlichkeit zu adulten Stammzellen aufweisen, können zum Beispiel im mütterlichen Gewebe der Leber, der Haut, der Milz, des Immunsystems etc. mehrere Jahrzehnte nachgewiesen werden. Ebenso lang finden sich DNA-Spuren fetusspezifischer Marker in den verschiedensten Organen.
Die Häufigkeit fetaler Mikrochimärismen scheint individuell stark zu variieren und hängt von der Schwangerschaftsdauer, der Anzahl der Geburten, den Blutgruppen- / HLA (Humanes Leukozyten-Antigen)-Übereinstimmungen sowie weiteren genetischen Faktoren ab.
Welche Auswirkungen die im mütterlichen Organismus bleibenden fetalen Zellen bzw. die fetale DNA haben, ist Teil der aktuellen Forschung. Hier stehen insbesondere die Relevanz des Einflusses auf die Immunregulation, die Gewebeerneuerung, Krankheitsverläufe sowie Transplantationen und Autoimmunkrankheiten im Vordergrund.
Neueste Ergebnisse belegen eine immunologische Auswirkung. Fetale Zellen können in immunologische Zellen mütterlicher Gewebe wandern. Dies kann zu einer modulierenden Wirkung auf die körpereigene Immunantwort beitragen und situativ sowohl gewebeschützende als aber auch gewebebelastende Auswirkungen haben. In diesem Zusammenhang wurden und werden Verbindungen zu Autoimmunerkrankungen, der Transplantat-Akzeptanz, Schwangerschaftskomplikationen und bestimmten Krebsarten diskutiert. Die Belege bleiben hier aber teils assoziativ und kontextspezifisch.
Eine Langzeitpersistenz fetaler Zellen kann also eine sowohl positive als auch negative Beeinflussung immunologischer Gleichgewichte der Mutter und eine Modulation antigenspezifischer Toleranzmechanismen darstellen. Die Anwesenheit fetaler Zellen könnte in manchen Fällen somit Immunreaktionen oder Akzeptanzmechanismen unvorhergesehen beeinflussen. Gelegentlich könnten fetale Zellen als fremd erkannt werden und chronische Entzündungsreaktionen oder autoimmune Prozesse beeinflussen.
Fetale Zellen können potenziell aber auch an Reparaturprozessen beteiligt sein und Gewebe frühzeitig unterstützen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass fetale Zellen oder deren Epigen-Profile als Biomarker für bestimmte Schwangerschafts- oder Immunparameter dienen können.
Der Nachweis und die Interpretation von fetalem Mikrochimärismus ist technisch anspruchsvoll und interpretationsempfindlich, da die potenziellen immunologischen und klinischen Auswirkungen je nach Individuum stark variieren.
Vieles bleibt weiterhin hypothetisch oder kontextabhängig, sodass unbedingt größere, systematische Studien nötig sind, um klare kausale Zusammenhänge und eine entsprechende klinische Relevanz zu definieren.
Die Tatsache aber, dass Mütter jahrzehntelang einen Teil ihrer Kinder weiter in sich tragen und die Kinder wiederum einen Teil ihrer Mütter, ist trotz der damit auch einhergehenden eventuellen Risiken, irgendwie eine berührende Vorstellung.
Hintergrund- und Detailwissen zum Thema Genetik erfahren Sie unter anderem zum Beispiel in unserer Seminarreihe  SE Nucleosan-Owner, Klinisch-Praktische (Tier)Genetik.
SE Nucleosan-Owner, Klinisch-Praktische (Tier)Genetik.

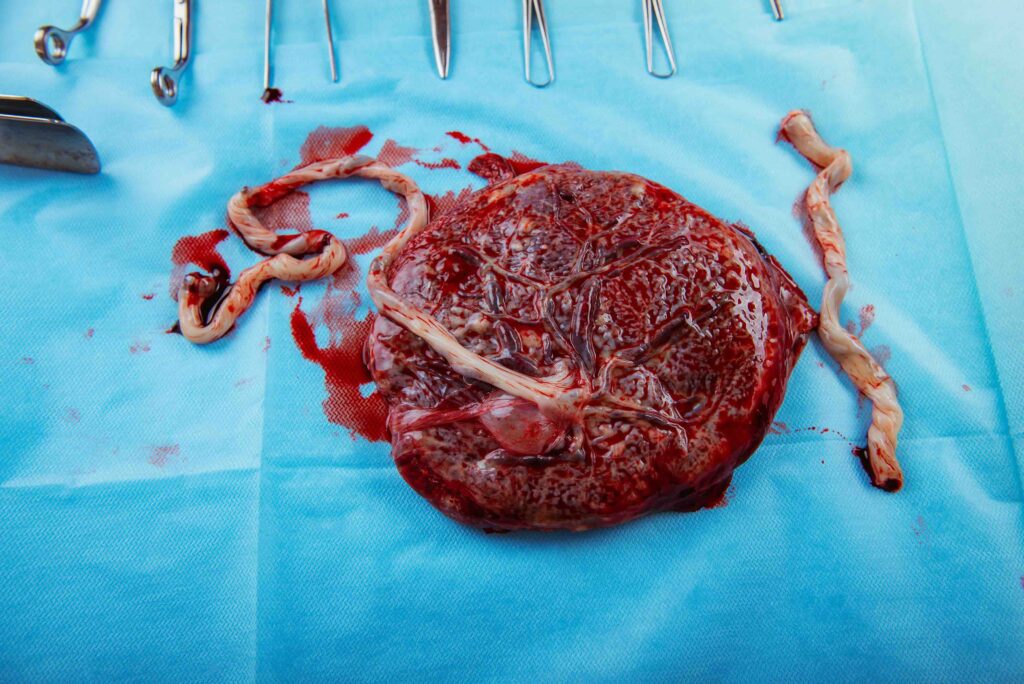

 c.hinterseher-Wissen!
c.hinterseher-Wissen!

Schreiben Sie einen Kommentar
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.