Die Tierheilpraktik – ein Weg zur ganzheitlichen Tiergesundheit
Die Ausbildung zur Tierheilpraktikerin und zum Tierheilpraktiker erfreut sich zunehmender Beliebtheit, da immer mehr TierbesitzerInnen alternative Heilmethoden für ihre vierbeinigen Freundinnen und Freunde in Betracht ziehen.
TierheilpraktikerInnen bedienen sich verschiedenster ganzheitlicher Therapiemethoden die darauf abzielen, das Wohlbefinden von Tieren zu fördern und ihre Gesundheit zu unterstützen, beziehungsweise wiederherzustellen. Im Vergleich zur Schulmedizin, die auf wissenschaftlich fundierten Methoden basiert, bietet die Tierheilpraktik einen Ansatz, der Körper, Geist und Seele des Tieres berücksichtigt.
Die Studieninhalte, die angehende Tierheilpraktikerinnen und Tierheilpraktiker beherrschen müssen, sind durchaus mit dem Wissen tierärztlicher Kolleginnen und Kollegen vergleichbar. Ein fundiertes Wissen der Anatomie und Physiologie des tierischen Körpers sowie das Verständnis für verschiedene Erkrankungen und deren Symptome bilden die Basis einer guten Ausbildung. Dabei sollte ausführlich auf tierartliche Besonderheiten eingegangen werden.
 Blog / News
Blog / News
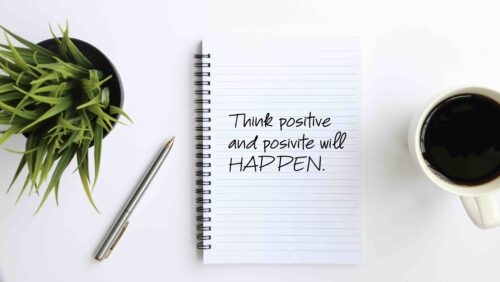








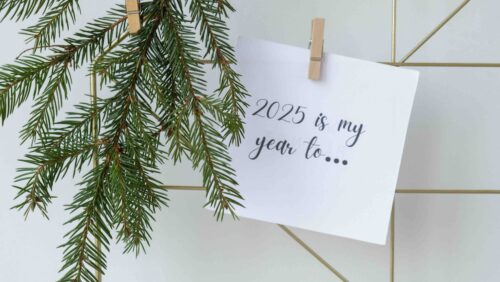





 c.hinterseher-Wissen!
c.hinterseher-Wissen!
